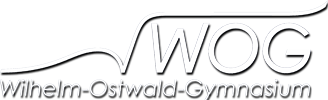Foto: Material über die Befreiung am 11. April 1945 (Dauerausstellung)
Am 6. November 2024 standen wir als Jahrgang 12 dort, wo vor nicht einmal 100 Jahren unaussprechlich grausame Verbrechen von Deutschen begangen wurden. Dort, wo Tausende Menschen gequält, ausgehungert und getötet wurden – im Konzentrationslager Buchenwald. Was uns zuerst auffiel: Kein Lärm, keine lauten Stimmen. Nur der kalte Wind und das beklemmende Gefühl, dass der Boden unter unseren Füßen mehr Leid kannte, als wir je begreifen könnten.
Wir sind dorthin gefahren, um zu lernen. Doch was wir mitgenommen haben, ist mehr als bloßes Wissen. Es ist ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht, das bleibt. Das Konzentrationslager Buchenwald wurde 1937 unter der Führung der Nationalsozialisten unweit von Weimar errichtet. Insgesamt 277.800 Häftlinge aus über 50 Ländern wurden hier von 1937 bis zur Befreiung am 11. April 1945 zur Zwangsarbeit gezwungen. Über 56.000 Menschen wurden grausam ermordet oder sind den unmenschlichen Bedingungen zum Opfer gefallen. Ursprünglich war das Lager für deutsche politische Gegner des NS-Regimes, vorbestrafte Kriminelle, sogenannte "Asoziale" sowie für Juden, Zeugen Jehovas und Homosexuelle vorgesehen. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden aber auch zunehmend Menschen aus anderen Ländern dorthin deportiert.
Unser Besuch nahm seinen Anfang mit einem informativen Film über das KZ Buchenwald. In zwei Gruppen geteilt, begann dann an den ehemaligen SS-Kasernen unsere Führung durch die Gedenkstätte. Wir setzten unseren Rundgang am sogenannten Caracho-Weg fort, wo früher die Häftlinge vom Bahnhof zum Lager getrieben wurden. Dann ging es vorbei an dem für SS- Soldaten in ihrer Freizeit errichteten Zoo bis hin zu dem Zaun und dem Tor, das das eigentliche Häftlingslager vom Rest abgrenzte. Besonders in Erinnerung ist uns die Uhr am Haupttor geblieben, die auf 15:15 Uhr eingestellt ist – die Uhrzeit, zu der das Lager von amerikanischen Soldaten befreit wurde.
Im Häftlingslager selbst sahen wir den Appellplatz mit dem Gedenkzeichen sowie das Krematorium mit der pathologischen Abteilung, dem Gedenkraum und der Verbrennungsanlage. Es ist mit Worten nicht zu beschreiben, was in uns vorging, als wir an den Stellen standen, wo Menschen andere Menschen so systematisch brutal unterdrückt und getötet haben.
Nach einer Mittagspause besuchten wir noch die Dauerausstellung zur KZ-Geschichte, wo auch ein Fokus auf die spätere Geschichte des Ortes als sowjetisches Speziallager Nummer 2 und als Gedenkstätte gelegt wurde.
Als Jahrgang hat uns dieser Besuch sehr geprägt. Es macht einen Unterschied, die Überreste dessen, worüber man im Geschichtsunterricht immer redet, nun wirklich einmal mit eigenen Augen gesehen zu haben. Es war zutiefst erschütternd, die einzelnen Schicksale dieser Menschen zu erfahren. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es uns aufs Tiefste verstört hat, zu sehen, zu welchen brutalen Taten Menschen fähig sind.
Genauso schockierend ist es aber auch zu hören, wie die Gedenkstätte in der heutigen Zeit noch Ziel von so viel Hass ist. Es macht uns traurig, zu wissen, wie respektlos und unverantwortlich manche Menschen mit diesem Gedenkort umgehen und womit die Mitarbeiter, die sich so viel Mühe geben, uns die Bedeutung dieses Ortes näherzubringen, täglich umgehen müssen.
Wir als Jahrgang sind deshalb dankbar dafür, dass unsere Lehrer uns diese Erfahrung ermöglicht haben. Denn wir wissen: Wir als Menschen in dieser Gesellschaft und in diesem Land haben die Möglichkeit und Pflicht, dem Hass gemeinsam entgegenzutreten. Wir tragen die Verantwortung dafür, aus unserer Vergangenheit zu lernen, damit sie sich nicht wiederholt. Denn Gedenken heißt nicht nur erinnern, sondern handeln – gegen das Vergessen und gegen den Hass in unserer Gesellschaft.
Anouk Falke, Casiana Forga